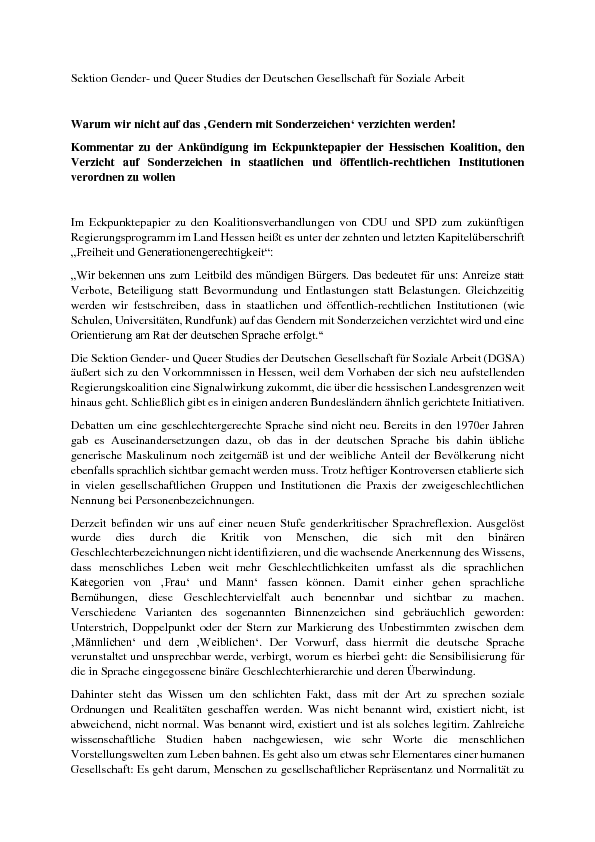
Der Vorstand der DGSA unterstützt das nachfolgende Statement der Sektion Gender- und Queer Studies der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit zur geschlechtergerechten Sprache ausdrücklich.
Im Eckpunktepapier zu den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD zum zukünftigen Regierungsprogramm im Land Hessen heißt es unter der zehnten und letzten Kapitelüberschrift „Freiheit und Generationengerechtigkeit“:
„Wir bekennen uns zum Leitbild des mündigen Bürgers. Das bedeutet für uns: Anreize statt Verbote, Beteiligung statt Bevormundung und Entlastungen statt Belastungen. Gleichzeitig werden wir festschreiben, dass in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen (wie Schulen, Universitäten, Rundfunk) auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird und eine Orientierung am Rat der deutschen Sprache erfolgt.“
Die Sektion Gender- und Queer Studies der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) äußert sich zu den Vorkommnissen in Hessen, weil dem Vorhaben der sich neu aufstellenden Regierungskoalition eine Signalwirkung zukommt, die über die hessischen Landesgrenzen weit hinaus geht. Schließlich gibt es in einigen anderen Bundesländern ähnlich gerichtete Initiativen.
Die Stellungnahme finden Sie hier.
Die Promotion ist im Wissenschaftssystem für die Qualifikation von Wissenschaftler*innen und die Entwicklung der Disziplin von zentraler Bedeutung. Diese Einschätzung teilen wir mit dem Wissenschaftsrat, der im April 2023 sein Positionspapier zur „Ausgestaltung der Promotion im deutschen Wissenschaftssystem“ veröffentlicht hat:
https://www.wissenschaftsrat.de/download/2023/1196-23.pdf?__blob=publicationFile&v=15
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) nimmt dies zum Anlass, in einem eigenen Positionspapier Standards des Promovierens für die Disziplin Soziale Arbeit zu formulieren und Stellung zu beziehen zu aktuellen Entwicklungen der Promotion an HAWen in der Sozialen Arbeit.
Der Vorstand der DGSA e.V. nimmt Stellung zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Qualifikationsbedingungen an deutschen Hochschulen. Dabei schließen wir uns dem Positionspapier des Vorstandes der Kommission Sozialpädagogik der DGfE an und formulieren ergänzende Forderungen, die sich auf die Situation und die Entwicklungen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften beziehen.
Positionspapier des Vorstandes der Kommission Sozialpädagogik der DGfE: https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Sektionen/Sek08_SozPaed/KSozPaed/2022_Positionspapier_junge_Wissenschaft_komm_sozpaed.pdf
Der Vorstands der DGSA hat zur Frage der Rahmenbedingungen, Zugänge und Ressourcen von Forschung in der Soziale Arbeit ein Positionspapier veröffentlicht.
Hintergrund dieses Positionspapiers sind die Erfahrungen mangelnder Zugänge zur Forschungsförderung, Forschungsinfrastrukturen und -ressourcen. Wissenschaft Soziale Arbeit ist bislang weder systematisch in der Systematik der DFG vorgesehen noch in den Förderkontexten der Wissenschaftsministerien des Bundes und der Länder verankert. Dadurch kann bislang die Fortentwicklung von Profession und Disziplin Sozialer Arbeit empirisch nicht systematisch untersucht werden. Es fehlen daher Erkenntnisse über Lebenssituationen und Perspektiven von Adressat*innen Sozialer Arbeit, Wissen und Handeln von Fach- und Leitungskräften, Analysen zu Interaktionen und Interventionen, Konzepten und Programmatiken, Organisationen sowie zu gesellschaftlichen Kontexten Sozialer Arbeit.
Dies hängt auch damit zusammen, dass Forschung der Sozialen Arbeit überwiegend an Hochschulen für Angewandte Wissenschaft (HAW) verortet ist und strukturell in zweifacher Weise übersehen wird: Erstens findet an HAW auch Grundlagenforschung statt und zweitens gibt es hier nicht nur Technikwissenschaft und Unternehmenskooperationen.
Der Vorstand der DGSA nimmt Stellung zum Thema Promovieren und Promotionsrecht an HAW/FH in der Sozialen Arbeit. Sie finden diese Stellungnahme hier.
Der Vorstand der DGSA hat Qualitätsstandards zur Einschätzung von dualen, trägernahen und regulären Studienangeboten der Sozialen Arbeit veröffentlicht. Mit diesem Papier werden zentrale Standards formuliert, die Studierenden, Arbeitgeber*innen, Lehrenden, Fachgesellschaften, Akkreditierungsagenturen und Hochschulpolitiker*innen helfen sollen, die inhaltliche, organisationelle und konzeptionelle Qualität von Studienangeboten in einer sich stark wandelnden Hochschullandschaft besser einschätzen zu können. Die Stellungnahme ist in einem umfangreicheren Konsultationsprozess in der DGSA und der Fachöffentlichtkeit entstanden. Sie finden diese Stellungnahme hier.
Der Vorstand der DGSA hat sich zum Referentenentwurf zur Reform der Psychotherapeutenausbildung vom 03. Januar 2019 mit einer Stellungnahme im Zuge der Beratung des Gesetzesentwurfs an Bundesminister Jens Spahn positioniert. Sie finden diese Stellungnahme hier.
Seit dem 29.11. wird die Amadeu Antonio Stiftung wegen der Handreichung „Ene, mene, muh – und raus bist du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik“ massiv öffentlich angefeindet. Durch gezielte Auslassungen, falsche Zitierungen und gewollte Missinterpretationen haben rechtspopulistische bis rechtsextreme „Alternativmedien“ den Eindruck erweckt, eine Handreichung zum Umgang mit konkreten Fällen von Rassismus und Rechtsextremismus wolle dazu anregen, die politische Einstellung der Eltern zu erfassen und zu kontrollieren.
Von Massenmedien in Form der „BILD“-Zeitung und von einigen Politiker*innen sind diese Unterstellungen ungeprüft übernommen worden, ohne sich mit der Handreichung auseinandergesetzt zu haben oder das Gespräch zu suchen. Seit der öffentlichen Diskussion haben die Stiftung und die Verfasser*innen täglich mehrere Hundert Hass-eMails und Drohanrufe erreicht; die Anfeindungen auf den Social Media Kanälen sind ungebrochen heftig. Unter den Verfasser*innen sind mehrere Mitglieder der DGSA.
Der Vorstand solidarisiert sich mit der Stiftung und den angegriffenen Wissenschaftler*innen und kritisiert die verkürzende Darstellung der Intention, der Inhalte und der Handlungsempfehlungen der Broschüre mit aller Deutlichkeit. Wir verweisen auf die inhaltliche Klarstellung der Amadeu Antonio Stiftung.
Der Vorstand der DGSA
Flucht und Asyl werden in Deutschland und der EU derzeit kaum noch als eine humanitäre Aufgabe, sondern primär als vermeintliche Bedrohungssituation diskutiert. Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) ein Positionspapier zur Asylpolitik erarbeitet, mit dem sie sich für eine solidarische Gesellschaft und den Erhalt des Rechts auf Asyl einsetzt. Das Positionspapier wurde der Bundesregierung übermittelt.
This DGSA position paper has been translated into an international version "Appeal for global solidarity and the safeguarding of the right to asylum". It is directed to international readers and has been sent to different international social work and human rights organisations.
Wir nehmen mit großer Sorge zur Kenntnis, dass die Verlagsgruppe Springer Nature mehr als eintausend wissenschaftliche Artikel aus ihrem Fachzeitschriftenprogramm für die Leser_innen in China bewusst und willentlich unzugänglich gemacht hat. Wie zahlreiche Pressorgane berichten, werden dabei vor allem Artikel zu regimekritischen Themen wie Tibet, Taiwan, die Kulturrevolution oder den gewaltsam niedergeschlagenen Aufstand von Tiananmen Platz seit einiger Zeit in China über SpringerLink auf Betreiben des Verlages nicht mehr erreichbar gehalten. Der Verlag beruft sich in einer Stellungnahme auf „lokale Regularien“ und relativiert, dass dabei nur „weniger als ein Prozent“ seiner wissenschaftlichen Artikel betroffen seien.
Wir sind irritiert zu sehen, dass sich ein wissenschaftlicher Fachverlag aktiv an Zensur und Geschichtsverklärung beteiligt und sich dem Druck einer Regierung beugt. Durch dieses Vorgehen negiert der Verlag seine wissenschaftliche und gesellschaftliche Funktion und Verantwortung als Fachverlag und zerstört sein wichtigstes Gut: Das Vertrauen seiner Leser_innen und Autor_innen und seine akademische und gesellschaftliche Glaubwürdigkeit. Im Umgang mit autokratischen und autoritären Regimen macht genau dieses eine Prozent der kritischen Beiträge den entscheidenden Umgang mit Meinungs- und Redefreiheit aus.
Als Vorstand und Fachgesellschaft fordern wir den Verlag Springer Nature auf, diese neue Art von Publikationspolitik umgehend zu überdenken und seine publizistische und gesellschaftliche Verantwortung wieder an die erste Stelle seiner Prioritäten zu stellen. Gerade in Zeiten von wieder erstarkenden autoritären, nationalistischen und totalitären Regimes muss ein wissenschaftlicher Verlag seiner Verantwortung gerecht werden.
Wir richten diese Forderung auch an die zu Springer Nature gehörenden Verlagssparten Springer VS und Palgrave Macmillan. In diesen Sparten publizieren viele unserer Mitglieder und stehen nun vor der Situation, als Autor_innen und Forschende mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, der die Interessen einer Regierung über die Interessen seiner Autor_innen und Vertragspartner_innen stellt und damit seine gesellschaftliche und publizistische Verantwortung negiert.
20. November 2017, für den Vorstand der DGSA:
Prof. Dr. Michaela Köttig und Prof. Dr. Barbara Thiessen
„Kritisches Denken und fundiertes Urteilen setzt voraus, dass es verlässliche Kriterien gibt, die es erlauben, die Wertigkeit von Informationen einzuordnen. Die gründliche Erforschung unserer Welt und die anschließende Einordnung der Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, ist die Aufgabe von Wissenschaft. Wenn jedoch wissenschaftlich fundierte Tatsachen geleugnet, relativiert oder lediglich „alternativen Fakten“ als gleichwertig gegenübergestellt werden, um daraus politisches Kapital zu schlagen, wird jedem konstruktiven Dialog die Basis entzogen.
Da aber der konstruktive Dialog eine elementare Grundlage unserer Demokratie ist, betrifft eine solche Entwicklung nicht nur Wissenschaftler/innen, sondern unsere Gesellschaft als Ganzes. Am 22. April 2017 werden deshalb weltweit Menschen auf die Straße gehen, um dafür zu demonstrieren, dass wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage des gesellschaftlichen Diskurses nicht verhandelbar sind.
Alle, denen die deutliche Unterscheidung von gesichertem Wissen und persönlicher Meinung nicht gleichgültig ist, sind eingeladen, sich an dieser weltweiten Demonstration für den Wert von Forschung und Wissenschaft zu beteiligen – nicht nur Wissenschaftler/innen!“
Weitere Informationen auf: http://marchforscience.de/
Insbesondere zum Umgang mit Hochschulangehörigen in der Türkei
Wir sind besorgt und entsetzt über die politischen Entwicklungen in der Türkei. Bereits vor dem Militärputsch hat der Druck auf die Wissenschaft zugenommen. Seit der Petition die hunderte Akademiker_innen in der Türkei verfasst haben mit der Aufforderung an die türkische Regierung, den bewaffneten Konflikt mit der verbotenen PKK im Südosten des Landes zu beenden, gelten sie als „Vaterlandsverräter“ und werden öffentlich als „Möchtegern-Akademiker“ diffamiert. Bereits damit begannen Entlassungen, Verhaftungen und Anklagen wegen Terrorpropaganda.
Am 19.7. wurde die Entlassung von 1.577 Universitäts-Dekanen angeordnet. Universitätsangestellte dürfen nicht mehr ausreisen. Türkische Akademiker_innen, die im Ausland arbeiten, sollen zurückkommen. Wer nicht heimkehrt, macht sich verdächtig. Dies ist ein Generalverdacht gegen Wissenschaftler_innen und Intellektuelle.
Wir fühlen uns mit den betroffenen Hochschulangehörigen tief verbunden und versichern ihnen unsere Solidarität. Mit Sorge sehen wir, wie mit einem Streich die langjährigen Kooperationen, Austauschbeziehungen und gemeinsamen Lehr- und Forschungsprojekte zwischen Deutschland und der Türkei in Gefahr geraten und aktuell akut verhindert werden. Gerade im Bereich der Sozialen Arbeit, die erst seit den 2000er Jahren systematisch in der Türkei aufgebaut wird, sind nun vielfältige Kooperationsprojekte in Gefahr.
Wir rufen die türkische Regierung dazu auf, die Repressionen und Verfolgungen zu stoppen und die demokratisch legitimierte Freiheit von Forschung und Lehre in der Wissenschaft nicht einzuschränken.
21. Juli 2016 Für den Vorstand:
Prof. Dr. Michaela Köttig
Prof. Dr. Barbara Thiessen
Weitere Stellungnahmen siehe:
Stellungnahme der DGSA zur Psychotherapieausbildung
Stellungnahme der DGSA zum CHE-Hochschulranking
Stellungnahme des Fachbereichstages Soziale Arbeit (FBTS) zur Einsetzung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)
Stellungnahme der Vorstände der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) und der Kommission Sozialpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) zur Lage der Sozialen Arbeit an den bundesdeutschen Hochschulen
Mit der Stellungnahme reagieren die Vorstände aus den beiden für die Soziale Arbeit relevanten bundesdeutschen wissenschaftlichen Fachgesellschaften auf die Zuspitzung der Situation an den hiesigen Hochschulen. Soziale Arbeit kann aber nur auf Basis einer breiten wissenschaftlichen Basis und entsprechenden akademischen Ausbildung von professionellen Fachkräften erbracht werden. Daher ist diese wissenschaftliche Grundlegung der hochschulischen Ausbildung in den nächsten Jahren nachhaltig zu sichern und weiter auszubauen. Auf diese Forderung zielen die beiden Vorstände mit der beiliegenden Stellungnahme.